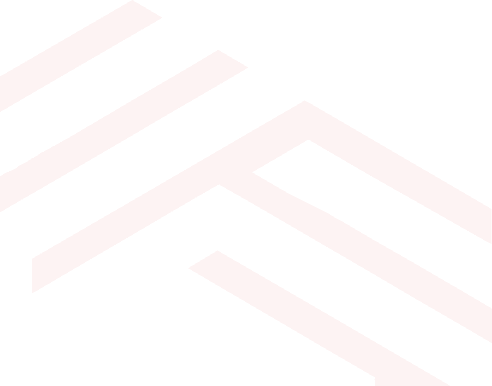Recht am eigenen Bild: Gesetzeslage
Das Recht am eigenen Bild StGB schützt jede Person davor, dass ihr Bild ohne berechtigten Grund gefertigt oder verbreitet wird. Während das Kunsturhebergesetz seit 1907 die zivilrechtliche Seite regelt, stellt § 201a StGB das unbefugte Herstellen oder Übertragen von Bildaufnahmen unter Strafe. Unerlaubte Aufnahmen sind strafbar – schon der Klick auf den Auslöser kann genügen. Neben dem Strafgesetz spielt das Recht am eigenen Bild Gesetz auch in § 22 ff. KUG eine Rolle: Dort wird festgelegt, dass grundsätzlich jede Veröffentlichung die „ausdrückliche Einwilligung“ der Abgebildeten verlangt. Sobald ein Unternehmen Fotos auf Social‑Media‑Kanälen teilt, wird es zum Verantwortlichen nach Art. 4 Nr. 7 DSGVO. Die Pflicht, über Zweck, Umfang und Persönlichkeitsrecht der Betroffenen zu informieren, bleibt also bestehen.
Das Urheberrecht auf Fotos ist ebenfalls zu beachten: Der Fotograf ist Urheber und kann Nutzungsrechte übertragen oder verweigern. Wer Bilder aus dem Internet übernimmt, muss kontrollieren, ob das Urheberrecht der Bilder aus dem Internet berührt ist – sonst drohen teure Abmahnungen nach dem Fotorecht. Je nach Schwere des Eingriffs in das höchstpersönliche Lebensbereich (§ 201a Abs. 1 Nr. 4 StGB) sieht das Gesetz Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren vor. Für Unternehmen kann die illegale Verwendung einer Aufnahme zusätzlich Bußgelder nach Art. 83 DSGVO bedeuten. Somit ist klar: Nur wenn Erlaubnis, Rechtsgrundlage und Zweckbindung sauber dokumentiert sind, können Sie Risiken vermeiden. Die Gerichte interpretieren das Recht am eigenen Bild heute in enger Verzahnung mit dem Datenschutzrecht. Das Bundesverfassungsgericht hebt immer wieder hervor, dass digitale Verbreitungsketten enormes Verletzungspotential bergen. Unternehmen müssen daher technische und organisatorische Maßnahmen etablieren, um unberechtigte Downloads oder Screenshots zu verhindern. Compliance‑Programme sollten verbindliche Freigabeprozesse, ein Archiv für Model‑Releases sowie regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter enthalten. Nur so wird aus einer theoretischen Pflicht eine gelebte Praxis, die Juristen und Marketing in Einklang bringt.
Recht am eigenen Bild: Definition und Grenzen
Ein unerlaubtes Foto liegt vor, wenn eine Aufnahme gezielt eine oder mehrere Personen erkennbar abbildet, ohne dass eine wirksame Einwilligung oder gesetzliche Ausnahme vorliegt. Erlaubt ist die Darstellung der Zeitgeschichte, wenn das Informationsinteresse der Öffentlichkeit den Eingriff überwiegt. Nicht erlaubt ist hingegen das »Mitarbeiter‑Selfie« für die Unternehmensbroschüre, wenn die Betroffenen nicht informiert sind.
Nach dem Urheberrecht bei Bildern schützt das Gesetz nicht das Motiv, sondern das konkrete Lichtbild. Der Bildrechte Fotograf bleibt Urheber, doch der Abgebildete behält das Recht am eigenen Bild. Unternehmen benötigen deshalb doppelte Rechte: Bildrechte Nutzungsrechte vom Fotografen und Zustimmung der Abgebildeten.
Neue Fragen wirft die KI‑gestützte Bildgenerierung auf. Entstehen Werke, die reale Menschen imitieren, greift die KI-Verordnung und das Bilder Urheberrecht sowie das Persönlichkeitsrecht.
Auch das Recht am eigenen Bild im öffentlichen Raum ist zu beachten: Straßenaufnahmen sind zulässig, solange abgebildete Passanten nur Beiwerk sind. Wer jedoch zoomt, nachverfolgt oder sensible Details herausfiltert, überschreitet die Grenze zur gezielten Personenaufnahme.
Was das Recht am eigenen Bild angeht, so ist für einen Verstoß stets die Identifizierbarkeit der Person erforderlich. Es kann also sein, dass auch dann, wenn kein Gesicht zu sehen ist, trotzdem das Recht am eigenen Bild verletzt ist, bspw. dann, wenn die Person durch andere Merkmale (wie zum Beispiel eine auffällige Tätowierung, eine körperliche Besonderheit, wie ein Muttermal o.ä.) erkannt werden kann. Somit können also auch Profilbilder ohne Gesicht das Recht am eigenen Bild verletzen.
Unerlaubtes Fotografieren von Personen kann zulässig sein, wenn eine der so genannten Schranken eingreifen. Das ist dann der Fall, wenn die Person Teil einer öffentlichen Versammlung, einer großen Menschenmenge o.ä. ist bzw. nur als „Beiwerk“ auf dem Foto anzusehen ist, also nicht im Vordergrund, nicht im Fokus des Bildes steht. Auch ein Ereignis der Zeitgeschichte kann fotografiert werden, auch wenn Personen erkennbar abgebildet sind. Dazu gehören alle Tagesereignisse von einem gewissen öffentlichen Interesse.
Beim Fotografieren von prominenten Personen ist bspw. zu fragen, ob die abgebildete Situation den engsten Lebensbereich betrifft, in dem auch eine prominente Person ein Recht auf ihre Privatsphäre hat. Unerlaubtes Fotografieren von Privatpersonen, also nicht in der Öffentlichkeit stehenden Personen ist insoweit wesentlich strenger zu sehen, als bei Personen, die allgemein in der Öffentlichkeit stehen.
Ohne Zustimmung oder Einwilligung dürfen also solche Bilder gemacht bzw. veröffentlicht werden, auf die eine der oben beschriebenen Schranken zutrifft (Bild eines Tagesereignisses von öffentlichem Interesse, Bild von Menschenmassen bzw. einer Versammlung oder einem Aufzug, wenn die Person nicht im Fokus steht oder Bild, bei welchem die Person nur als Beiwerk anzusehen ist, also das Bild auch ohne die Person nichts von ihrem Charakter verlieren würde).
Praktisch bedeutet das: Fertigen Sie Bilder bevorzugt in kontrollierten Umgebungen, nutzen Sie Release‑Formulare und dokumentieren Sie Widerrufsrechte. Verzichten Sie auf Uploads in amerikanische Clouds, wenn kein angemessenes Datenschutzniveau garantiert ist. Durch frühzeitige Rechts‑Checks vermeiden Sie Konflikte mit Urhebern und Betroffenen gleichermaßen. Ein kurzer Blick in die Praxis zeigt: Schon das Anfertigen einer scheinbar harmlosen Team‑Aufnahme in der Produktion kann heikel werden, wenn sensible Dinge sichtbar sind. Oft vergessen Verantwortliche, dass das Hausrecht des Arbeitgebers nicht automatisch das Persönlichkeitsrecht der Beschäftigten außer Kraft setzt. Dokumentieren Sie daher klar, wer welche Bilder für welchen Zweck verwenden darf. Hinterlegen Sie Löschfristen, falls eine Kampagne endet oder Mitarbeitende das Unternehmen verlassen. Vertrauen ist gut – rechtssichere Verträge sind besser.
Strafen und Sanktionen
Wer das Recht am eigenen Bild verletzt riskiert eine Strafe. Daher sollten Sie die Bandbreite möglicher Sanktionen kennen. Strafen treffen nicht nur Privatpersonen – auch Geschäftsführer haften bei Organisationsverschulden.
§ 201a StGB sieht Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe vor, wenn jemand unerlaubt Bildaufnahmen herstellt oder Dritten zugänglich macht. Die häufigste Konstellation lautet: »Verletzung des Rechts am eigenen Bild« durch das Posten auf Social Media. Ist der Betroffene minderjährig oder befindet er sich in einer hilflosen Lage, erhöht sich das Strafmaß.
Wie hoch eine Geldstrafe bei Verletzung des Rechts am eigenen Bild ausfällt, hängt von Einkommen, Schadenshöhe und Tatmotiv ab. Gerichte orientieren sich an Tagessätzen; bei Unternehmen kommen DSGVO‑Bußgelder bis 20 Mio. € oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes hinzu.
Die Veröffentlichung von Fotos ohne Zustimmung verursacht eine Strafe. Doch das ist nur der strafrechtliche Teil – zivilrechtlich kann zusätzlich Schadensersatz für immaterielle Schäden verlangt werden.
Täter, die unerlaubt Fotos machen trifft eine hohe Strafe, insbesondere wenn dies geschieht, um andere zu erpressen oder die Fotos in Chats zu verbreiten.
Bei Fotos von Kindern ohne Einwilligung kann die Strafe insoweit höher ausfallen, als bspw. das Datenschutzrecht Minderjährige besonders schützen will und die Datenschutzbehörden als Bußgeldstellen ein Ermessen bei der Höhe der Bußgelder haben. Ähnliches könnte bei strafrechtlicher Verurteilung gelten. Bei Nacktbildern von Minderjährigen, die zu Erwerbszwecken hergestellt werden, sieht § 301 Abs. 3 StGB ausdrücklich höhere Strafen vor.
Ansonsten dürfte hier aber ein Unterschied gemacht werden. Insoweit haben die gesellschaftlichen Moralvorstellungen keinen Einfluss auf rechtlich begründete Ansprüche.
Wenn Sie WhatsApp Bilder weiterleiten, kann das dann strafbar sein, wenn der Tatbestand des § 201a StGB erfüllt ist. Der Tatbestand ist aber nicht ohne Weiteres bei jedem Bild erfüllt. Vielmehr gibt es bestimmte Fallgruppen, die eine Strafbarkeit auslösen. Dazu gehören bspw.:
- Es muss der höchstpersönliche Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt sein oder
- Es muss um ein Bild gehen, das in grob anstößiger Weise eine verstorbene Person zur Schau stellt oder
- Es muss unbefugt von einer anderen Person eine Bildaufnahme einem Dritten zugänglich gemacht worden sein, die geeignet ist, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu schaden.
Das gilt natürlich für alle Messenger gleichermaßen und auch für Social Media Accounts u.ä.
Durch die genannten Beispiele sieht man, dass das unerlaubte Fotografieren von Personen als solches noch keine Strafbarkeit auslöst. Vielmehr müssen Umstände hinzutreten, die eine Strafbarkeit auslösen.
Ungeachtet der Strafbarkeit kann aber zivilrechtlich ein Anspruch bestehen (auf Unterlassung, auf Schadensersatz u.ä.) und es kann ein datenschutzrechtlicher Anspruch entstehen, bspw. wenn die Verarbeitung des Fotos gegen die Grundsätze der DSGVO verstößt. Hier sieht Art. 82 DSGVO Schadensersatzansprüche der betroffenen Personen vor.
Dasselbe gilt für das Filmen von Personen ohne Einwilligung und die drohende Strafe oder die
Veröffentlichung von Fotos ohne Zustimmung und die drohende Strafe.
Neben solchen Strafen und Ansprüchen drohen auch hohe Reputationsschäden: Presseberichte über unzulässige Fotografie im Unternehmen führen zu Vertrauensverlust bei Kunden und Mitarbeitern. Setzen Sie daher auf Prävention: Schulungen, klare Policies und technischer Upload‑Filter verhindern, dass verbotene Inhalte online gehen. Falls es dennoch zum Ermittlungsverfahren kommt, reagieren Sie kooperativ, sichern Beweismaterial und lassen Sie frühzeitig die Rechtslage prüfen – dann bestehen Chancen auf Einstellung gegen Auflage.
Nicht zu unterschätzen ist außerdem der Verlust steuerlicher Begünstigungen bei geförderten Projekten, wenn Compliance‑Verstöße publik werden. Denn zahlreiche Förderrichtlinien setzen den Nachweis gesetzeskonformer Datenverarbeitung voraus. Wer hier patzt, muss Fördergelder zurückzahlen.
Handlungsmöglichkeiten für Betroffene
Sind Sie selbst betroffen, weil jemand ohne Einwilligung Ihr Foto nutzt, haben Sie mehrere Optionen. Handeln Sie zügig, sonst verjährt Ihr Anspruch. Erste Maßnahme: Screenshot anfertigen und die URL sichern. Mit diesen Beweisen formuliert Ihr Anwalt Bildrechte eine Abmahnung auf Grundlage von Ihrem „Recht an eigenem Bild“ und Ihrem Persönlichkeitsrecht. In vielen Fällen genügt das, um die Veröffentlichung von Fotos im Internet ohne Zustimmung stoppen zu lassen.
Bleibt der Gegner untätig, können Sie einstweilige Verfügung beantragen oder Strafanzeige stellen. Gleichzeitig lässt sich die Löschung bei Suchmaschinen anstoßen. Unternehmen sollten ein internes Meldeverfahren einrichten, damit eigene Mitarbeiter rasch reagieren können, falls sich Betroffene beschweren.
Die Rechte auf Bilder umfassen ferner Anspruch auf Auskunft, wo das Foto gespeichert wird und an wen es übermittelt wurde. Nutzen Dritte das Bild in Print‑Medien, besteht Unterlassungs‑ und Beseitigungsanspruch. Werden private Bilder veröffentlicht, wird ggf. eine Straftat begangen. Dann steht neben Unterlassung auch Schmerzensgeld im Raum. Wichtig ist, Fristen einzuhalten: Unterlassungsansprüche verjähren meist nach drei Jahren ab Kenntnis. Prüfen Sie daher umgehend, ob Ihre Rechte verletzt wurden, und sichern Sie Beweise lückenlos.
Unternehmen sollten zudem einen festen Ansprechpartner benennen, der Meldungen koordiniert und mit der Rechtsabteilung abstimmt. Ein internes Verzeichnis von Bildrechten erleichtert den Nachweis, dass eine gültige Einwilligung vorlag.
Verweigert der Rechteinhaber jede Nutzung, muss das Foto aus sämtlichen Medien, Werbemitteln und Backups entfernt werden – inklusive archivierter Social‑Media‑Posts. Prüfen Sie abschließend, ob verknüpfte Inhalte wie Thumbnails oder Vorschaubilder ebenfalls gelöscht sind, um keine Restverbreitung zu riskieren. Ein konsequentes Löschkonzept schützt so Reputation und vermeidet Folgeprozesse.
Recht am eigenen Bild: Einwilligung und Formulare
Damit eine Einwilligung wirksam ist, muss sie freiwillig, informiert, spezifisch und unmissverständlich erfolgen. Vorstände, HR‑Verantwortliche und Marketing sollten standardisierte Bildrechte Einverständniserklärung Formulare einsetzen. Klare Formulare vermeiden Streit. Das Dokument sollte den Zweck, Umfang, Dauer sowie die Nutzungsrechte der Fotos aufzählen und die Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs erläutern.
Wer Bilder langfristig nutzen möchte, kann eine Abtretung der Bildrechte vereinbaren. Dabei überträgt der Fotograf ausschließliche Nutzungsrechte gegen Vergütung. Die Abtretung ersetzt jedoch nicht das Persönlichkeitsrecht der Abgebildeten – deren Einwilligung bleibt zwingend. Fehlt sie, droht Unterlassung trotz vertraglich übertragener Rechte.
Digitale Workflows erleichtern die Verwaltung: Intranet‑Portale ermöglichen es Mitarbeitern, ihre Zustimmung mit einem Klick zu erteilen oder zu widerrufen. Alle Release‑Dokumente sollten versioniert abgespeichert werden; Änderungen müssen nachvollziehbar bleiben. Ergänzend empfiehlt es sich, eine Checkliste für Veröffentlichung zu erstellen, die vor jedem Upload abgehakt wird. So stellen Sie sicher, dass die Einwilligung zum Medium, zum Kanal und zum konkreten Inhalt passt. Widerruft eine Person später, muss das Unternehmen das Bild umgehend offline nehmen und aus Marketingmaterialien entfernen. Bleibt das Bild online, riskieren Verantwortliche Bußgeld und Imageschaden.
Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Zustimmung aller Sorgeberechtigten nötig. Im Zweifel holen Sie schriftliche Erklärungen beider Elternteile ein. Arbeitnehmer können zwar vertraglich verpflichtet sein, an Fotosessions teilzunehmen, jedoch nicht, der Veröffentlichung im Internet unbegrenzt zuzustimmen. Verwenden Sie daher separate Formulare für Aufnahme und Veröffentlichung. Prüfen Sie zudem den Einsatz modularer Lizenzbausteine: So lässt sich z. B. festlegen, dass Printnutzung zulässig, Social Media jedoch ausgeschlossen ist. Ein späterer Widerruf wirkt nur für die Zukunft, bestehende Druckauflagen dürfen weiterverbreitet werden. Transparenz bei diesen Punkten erspart teure Nachverhandlungen.
Vorlagen für Einwilligungen für Fotos nach DSGVO, Muster einer Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Videos, eine Vorlage einer Einverständniserklärung zur Verwendung von Fotos, auch für Social Media, Messenger etc. erstellen wir für unsere Mandanten sehr gerne.
Fotografieren oder Filmen zur Beweissicherung – ist das erlaubt?
Ja, wenn Sie ohne Aufnahmen keine Möglichkeit haben, eine Straftat zu dokumentieren. Dabei dürfen jedoch keine Aufnahmen veröffentlicht werden; sie dienen ausschließlich Gericht oder Polizei. Wenn Sie Fotos von Personen machen als Beweismittel, bspw., weil diese eine Straftat begehen oder begangen haben, ist das grundsätzlich zulässig, weil i.d.R: das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung überwiegt.
Bei bloßen Ordnungswidrigkeiten ist das nicht uneingeschränkt so, sondern es muss die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden. Aber auch hier wird man grundsätzlich nicht mit Sanktionen rechnen müssen, da auch bei reinen Ordnungswidrigkeiten ein Verfolgungsinteresse der Öffentlichkeit bejaht werden kann.
In den Fällen, in denen ein öffentliches Interesse an der Aufklärung der Ordnungswidrigkeit besteht, können Gerichte solche Fotos auch ohne Zustimmung als Beweismittel zulassen, z.B. bei schwerwiegenden Ordnungswidrigkeiten.
FAQ – Häufige Fragen
Ab wie vielen Personen darf man ein Bild veröffentlichen?
Das KUG erlaubt Aufnahmen von Versammlungen, wenn eine unbestimmte Zahl Menschen gezeigt wird und einzelne nicht herausgestellt sind. Sobald eine Person erkennbar im Vordergrund steht, benötigen Sie ihre Einwilligung.
Fotografieren von Personen zu Beweiszwecken
Hier gilt, wie beim Filmen: Die Aufnahme darf nur zur Dokumentation genutzt und nicht in sozialen Netzwerken geteilt werden. Veröffentlichen ist unzulässig, wenn die Betroffenen identifizierbar sind.
Darf ich jemanden filmen der mich bedroht?
In einer Notwehr‑ oder Notstandslage ist das zulässig, solange Umfang und Dauer angemessen bleiben.
Darf mich jemand mit dem Handy filmen?
Nur mit Einwilligung oder bei berechtigtem Interesse, etwa Überwachungskameras mit ausreichendem Hinweisschild.
Darf man fremde Autos fotografieren?
Nummernschilder gelten als personenbezogene Daten. Veröffentlichen ist nur erlaubt, wenn Kennzeichen unkenntlich gemacht werden oder überwiegendes Informationsinteresse vorliegt.
Darf man fremde Menschen fotografieren?
Ohne Einwilligung nicht, es sei denn, die Betreffenden sind lediglich Beiwerk einer Landschafts‑ oder Stadtaufnahme.
Bilder veröffentlichen ohne Gesicht – genügt das?
Nein. Auch Tattoos, Kleidung oder Standort können Rückschlüsse zulassen. Unkenntlichmachung des Gesichts ersetzt nicht die Einwilligung.
Ist Bilder weiterschicken strafbar?
Ja, wenn dadurch das Bild unbefugt weiteren Empfängern zugänglich gemacht wird. Dann liegt ebenfalls eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild vor.
Darf man Häuser fotografieren?
Gebäude dürfen grundsätzlich von öffentlichen Wegen aus fotografiert werden. Innenaufnahmen oder Aufnahmen über Zäune hinweg, sowie nach aktueller Rechtsprechung auch Drohnenaufnahmen erfordern das Einverständnis des Eigentümers, ggf. auch des Urhebers, also des Architekten oder Künstlers (bei Denkmälern o.ä.).
Darf ich in der Öffentlichkeit filmen?
Grundsätzlich ja, sofern Passanten nur Beiwerk sind. Tonaufnahmen dürfen jedoch § 201 StGB nicht verletzen.
Darf ein Detektiv Fotos machen?
Detektive haben keine Sonderrechte. Sie müssen dieselben Regeln einhalten wie jeder andere und können sich nicht auf das Hausrecht des Auftraggebers berufen.
Unerlaubtes Fotografieren auf einem Privatgrundstück: Was sind die Konsequenzen?
Bei einem Privatgrundstück kommt zusätzlich zum Recht am eigene Bild das Hausrecht des Eigentümers in Betracht. Es liegt hier eine Eigentumsbeeinträchtigung vor. Insoweit sollte auf privaten Grund nicht ohne Einwilligung Fotografiert werden, insbesondere dann, wenn der Eigentümer damit nicht rechnen muss und wenn die Bilder veröffentlicht werden sollen.
Darf man Menschen in der Öffentlichkeit filmen?
Wie oben schon etwas ausführlicher dargelegt, ist das dann möglich, wenn man nicht einzelne Personen filmt, sondern eine Menge an Menschen, die sich an einem öffentlichen Ort aufhält. Sind einzelne Menschen zwar auf dem Bild zu sehen, könnten aber auch ohne Veränderung des Charakters des Bildes verschwinden, liegt in der Regel kein Verstoß gegen das Recht am eigenen Bild vor.
Darf ich Personen im öffentlichen Raum fotografieren?
Auch hier gilt: In Der Regel nur mit Einwilligung der Person(en), ausnahmsweise dann, wenn eine der in diesem Artikel genannten Ausnahmen vorliegt.
Darf jemand mein Haus fotografieren und veröffentlichen?
Grundsätzlich ja, solange dies von einem Ort aus geschieht, der für die Öffentlichkeit zugänglich ist (so genannte Panoramafreiheit). Das gilt nach neuer Rechtsprechung aber bspw. nicht bei Drohnenaufnahmen aus der Luft. Im Kern darf kein Hindernis überwunden worden sein, um das Bild zu machen.