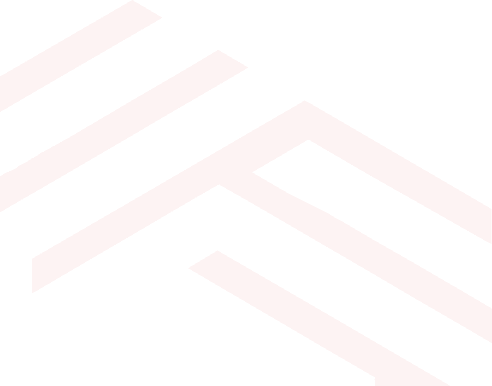Sobald eine Person in einem Fernsehausschnitt, Video oder Foto erkennbar ist, muss sie grundsätzlich vor der Herstellung des Fotos um Erlaubnis gefragt werden. Hier kommen zwei Rechtsgebiete zum Tragen: Das Persönlichkeitsrecht und das Datenschutzrecht. Beginnen wir mit dem Persönlichkeitsrecht, das u.a. im sog. Kunsturhebergesetz (KUG) geregelt ist. Wie eingangs gesagt: Grundsätzlich ist eine Einwilligung erforderlich, wenn man jemanden fotografieren möchte.
Von diesem Grundsatz gibt es mehrere Ausnahmen, bei denen die Person nicht vorher gefragt werden muss:
- Die abgebildete und erkennbare Person gibt ihre Zustimmung. Die Zustimmung wird vom Gesetz vermutet, wenn die Person Geld für die Abbildung bekommt.
- Die Person ist nur “Beiwerk” auf dem Bild. Sie ist also nicht ein zentrales Element, bei deren Weglassen das Bild nicht mehr verwendet werden würde. Es spielt für das Bild keine Rolle, ob die Person zu sehen ist, die Person erscheint zufällig und ist austauschbar. Wer als Beiwerk auf einem Bild erkennbar ist, muss dies also grundsätzlich hinnehmen.
- Die Person ist eine Person der Zeitgeschichte, sie steht also im Interesse der Öffentlichkeit. ACHTUNG: Wird das Bild in der Werbung eingesetzt, muss auch die Person der Zeitgeschichte um Erlaubnis gefragt werden.
- Diese Ausnahme gilt auch, wenn die Person an einem Ereignis der Zeitgeschichte teilnimmt. Dies kann bspw. eine lokal, regional oder national bedeutende Veranstaltung sein, wie eine Weltmeisterschaft oder auch ein Sommerfest eines in der Stadt relevanten Unternehmens. Die daran teilnehmenden Personen müssen quasi damit leben, dass sie auch fotografiert bzw. gefilmt werden, weil ausnahmsweise das zeitgeschichtliche Ereignis und die Berichterstattung darüber bzw. Werbung damit „wichtiger“ sein darf.
- Die Person ist Teilnehmer einer Versammlung (damit sind Demonstrationen gemeint, und keine klassischen Events) und ähnliche Vorgänge. Allerdings fallen die Events unter den Begriff der “ähnlichen Vorgänge”, weshalb Fotos in die Zuschauermenge hinein erlaubt sind. Die dabei erkennbaren Einzelpersonen müssen damit leben, dass sie erkennbar gezeigt werden.
 Aber:
Aber:
Diese Ausnahme rechtfertigt es nicht, dass das Fernsehen aus der Masse heraus eine einzelne Person herauszoomt und vergrößert darstellt. Solche Aufnahmen sind rechtswidrig (auch wenn sie tatsächlich gemacht werden, weil sich kaum jemand wehrt). Das Foto bzw. der Film in die Menschenmenge, in der Personen erkennbar sind, ist nur gestattet, soweit dadurch ein repräsentativer Eindruck des Geschehens vermittelt wird.
Einzelbilder sind dadurch nicht gedeckt – abhängig vom Motiv: Was ist das Motiv des Bildes? Geht es darum, den Menschen zu zeigen? Oder geht es darum, die Veranstaltung bzw. das Gebäude zu zeigen, und es sind quasi eher zufällig auch Menschen zu sehen?
Im Übrigen sind unerlaubte Aufnahmen von Personen oder dem gesprochenen Wort auch strafbar!
Das “Recht am eigenen Bild” ist ein so genanntes Persönlichkeitsrecht. Daneben greifen die Grundsätze des Datenschutzrechts:
Datenschutz?
Das erkennbare Gesicht ist ein personenbezogenes Datum. Wird dieses verarbeitet (erhoben, gespeichert, verwertet), dann sind u.a. die Grundsätze der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einzuhalten.
U.a. benötigt der verantwortliche Datenverarbeiter (bspw. der Veranstalter) eine Rechtsgrundlage, um das Datum „Gesicht“ verarbeiten zu dürfen. Zwei bekannte Rechtsgrundlagen sind die Einwilligung und das berechtigte Interesse (siehe Art. 6 DSGVO).
Einwilligung
Mit einer Einwilligung wird es einfach: Ist der Einwilligungstext ordentlich formuliert und die Einwilligung erteilt, darf man das machen, was von der Einwilligung abgedeckt ist. Wichtig: Hinzu kommen muss natürlich immer eine Datenschutzerklärung, die dem Betroffenen (z.B. Zuschauer) zur Verfügung gestellt werden muss (z.B. durch Aushang).
Übrigens: Der Aushang „Hier werden Fotos gemacht“ o.ä. genügt nicht als Einwilligung, wenn der Zuschauer an dem Aushang einfach nur vorbeigeht. Es würde allenfalls reichen, wenn er davor steht und bspw. durch deutliches Kopfnicken seine Zustimmung erteilt (die der Veranstalter dann aber nicht wird beweisen können). Daher macht es Sinn, die Einwilligung bspw. durch eine Checkbox bei einer Online-Anmeldung oder schriftlich zu beschaffen. Man sieht aber: Im Massengeschäft großer Veranstaltung ist das problematisch.
Berechtigtes Interesse
Mithilfe der oben beim Persönlichkeitsrecht genannten Ausnahmen (u.a. Beiwerk oder insbesondere die Zeitgeschichte) kann der verantwortliche Datenverarbeiter sein berechtigtes Interesse begründen, das damit das Gegen-Interesse an der Nicht-Verarbeitung des Betroffenen übersteigen kann.
Beispiel: Geladene Gäste nehmen an einer Jubiläumsveranstaltung eines großen Unternehmens in der Stadt XY teil. Das dürfte ein Ereignis der Zeitgeschichte sein, so dass der Veranstalter/das Unternehmen damit begründen könnte, Fotos zu Werbezwecken für dieses Ereignis machen zu dürfen.
Zum Verständnis: Der Betroffene kann ja jederzeit widersprechen, ebenso, wie er eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen könnte.
Urheberrecht
Hierneben besteht regelmäßig auch ein Recht des Fotografen an dem Bild bzw. des Produzenten an dem Film: Das Urheberrecht. Bei Verwendung von Fotos mit erkennbaren Personen darauf muss der Verwender also
- die abgebildete, erkennbare Person um Erlaubnis fragen, sofern nicht eine der oben genannten Ausnahmen zutrifft, und
- den Fotografen um Erlaubnis fragen. Im Urheberrecht sind die Ausnahmen, in denen der Fotograf nicht um Erlaubnis gefragt werden muss, in den so genannten Schranken geregelt (§ 44a – § 63a Urheberrechtsgesetz).
Informieren Sie sich hier über das Recht am eigenen Bild inklusive strafrechtliche Aspekte.